Ja. Ich schlafe weniger, also quasi nie, bin so unspontan wie selten, mache mir dauernd Kindersorgen und Müßiggang ist nicht.
Hallo, ich bin Dominic, und ich bin kaffeesüchtig.
Bei mir hat sich am Kaffeekonsum gezeigt. In der Elternzeit bin ich mit einem Becher Kaffee pro Tag gut hingekommen. Den habe ich wirklich gebraucht. Fragen Sie meine Frau. Und meinen ältesten Sohn. „Papa, (ich) koch dir einen Kaffee!“
Einmal Cookie-Policy muss ich leider abziehen
Gefunden bei Creative Bloq. Auweia.

Was in Breaking Bad an ein Startup erinnert (Staffel 1 und 2)
Walter White und Jesse Pinkman gründen ein Startup.

Natürlich hatte ich nicht als erster diese Idee. Ich habe mindestens sechs Artikel gefunden, die genau den gleichen Ansatz hatten. Zumindest wenn man es auf die Schnittmenge Breaking Bad und Startup reduziert. (Diese Schnittmenge soll auch meine krude Grafik symbolisieren. Betrachten wir es als Hommage an den qualmenden Vorspann mit den Elementen-Symbolen aus der Chemie.)
Im ersten wird die Wandlung von Walter White zu Heisenberg als Pivot beschrieben. Aber in der Startup-Welt wird die Wandlung von einem Handelnden nicht so genannt, sondern eine Neuausrichtung der Firma. Die gibt es in der Tat. Um seine Rücklagen für die Familie schneller aufzubauen, geht Mr. White das Vertriebsgeschäft von Account Manager Pinkman nicht schnell genug. Der ist schwer am „hustle“, aber das Endkundengeschäft ist kleinteilig und hält auf. In Google-Sprech: Es skaliert nicht. Weil es sehr menschlich ist.
Die Iteration hin zum blauen Meth ist ein weiterer Pivot. Für Hardware-Startups wie Breaking Bad, Inc. ist die Versorgung mit Rohstoffen ein zentraler Punkt. Wenn man sich Kickstarter-Kampagnen anschaut wie Sense oder Pebble, weite Teile der Blogeinträge lesen sich wie Reiseberichte aus China. Zugegeben, aus chinesischen Fabriken. Aber China ist nun mal die Werkbank der Welt geworden. Auch bei Apple wird immer wieder von Analysten gelobt, dass das Unternehmen die Supply Chain kontrolliere. Walter White weiß sich zu helfen, als er den Umsatz anheben will für die Zusammenarbeit mit Vertriebsprofi Tuco und dessen Organisation. Er stellt von Pseudos auf ein anderes Ausgangsmittel, Methylamin, um. Das verändert zwar das Produkt, aber das Blau erweist sich als besonderes Alleinstellungsmerkmal eben dieses Produkts.
Der erste Text beschäftigt sich auch mit den beiden Gründern. Wie in vielen Startups bringen die beiden Problempotenzial gleich mit. Beide glauben, das Wesentliche zum Gelingen des Unternehmens beitragen zu können. White ist der technische Co-Founder, der wenig Business-Knowhow hat. Der Straßengangster Jesse kennt sich aus, weiß über den Markt und seine bisherigen Vorlieben Bescheid. Aber das ist auch das, was ihn bremst. Er kann nicht wirklich disruptiv denken. Er will nur eine entstandene Nische ausfüllen und im Getriebe ein neues Zahnrad werden. Vielleicht ein größerer. Wogegen Heisenberg…
Sogar Mashable hat den Zusammenhang hergestellt. Interessanterweise kümmert sich aber der Artikel um die Finanzierung, aber um die spätere. Die Anschubfinanzierung ist viel spannender. Für das Wohnmobil, in dem zu Beginn das Meth gekocht wird, hebt Walter White Geld vom Sparkonto ab.
Aber die Bedeutung der Gründer für ein Startup wird in dem Artikel gut beschrieben. Jesse Pinkman erweist sich als gute Wahl. Immer dann, wenn man Pinkman als Zuschauer abgeschrieben hat, kommt dieser wieder mit einer guten Idee oder etwas Überraschendem daher. Die Reaktionen zwischen den beiden sind heftig, aber die Chemie stimmt immer wieder. (Achtung, Wortwitz.)
Auch AllThingsD lobt die richtige Gründerauswahl im diesem Startup-Vergleich.
Übrigens: Eigentlich ist da gar kein Startup gegründet worden. Der Markt ist immer noch der gleiche.
tl;dr
Das Gründen eine Drogenimperiums ist so wie das Gründen eines Startup: Hoffnung auf einen tollen Exit.
UX Munich: Impressionen und Fazit
Mich kann man leicht beeinflussen. Äußere Eindrücke verändern mein Denken. Das ist wohl bei vielen Kreativen so, wenn sie Inspirationen suchen. Früher waren das Filme. „Matrix“ war einer davon. Zwei Tage lang danach sah die Welt nicht mehr so aus, wie ich sie gewöhnt war. Gute Konferenzen sind genauso. Für mich sind die gewissermaßen die Bewusstseinsveränderung des denkenden Menschen.
In der Mittagspause des zweiten Tages von UX Munich 2015 setzte bei mir dieser Effekt zum ersten Mal ein. Ich sah die Welt durch die Brille von Analytics, User Research, User Stories und anderen Dingen, von denen Redner wie @ohrworm vorher erzählt hatten.
Russ-Mohl: „Wahrheit in Meer von Desinformation“
Ein leitender Redakteur eines als großer Medienerfolg gefeierten Magazins schickte mir Infos über sein Medienunternehmen, um mich zu einer Story zu motivieren. Unter den wesentlichen Aktivitäten für das kommende Jahr stand da: „Mehr Vermählungen von Storys und Brands“ für diverse Kunden. Wie klingt das in Ihren Ohren?
Russ-Mohl: Schrecklich. Ich plädiere für Scheidung vor der Hochzeit.
via Russ-Mohl: „Wahrheit in Meer von Desinformation“ – Werbung & PR – derStandard.at › Etat.
Das kann man wohl kaum besser sagen. Aber für Buzzfeed funktioniert es halt.
Der Perry der Woche
Mal sehen, ob es eine neue Rubrik in diesem Blog wird. Aber diese beiden GIFs wollte ich seit Wochen schon mit allen Teilen. Gut, dass es jemand im Internet schon gemacht hat, dieses Bild.
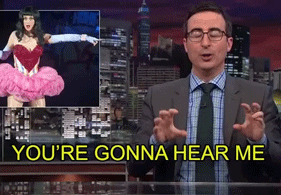

UX Munich: Conrad Albrecht-Buehler – warum er sich entschied, als Designer tiefer mit in die Umsetzung zu gehen
Als Designer, bin ich wirklich gut? Und woran erkenne ich das?
Ist der Designer, mit dem ich arbeite, gut?
- Finden andere meine Arbeit gut?
- Verdiene ich damit viel Geld?
- Kriege ich Geld für mein abgeschlossenes Konzept?
- Technik konnte es nicht bauen
- Budget gestrichen
- Business Case ging nicht auf
- Firma pleite
- Wettbewerb hat sich verändert
- Produkt bekam Nachfolger
These 2: Ich kann beeinflussen, ob mein Produkt auf den Markt komme. Ich sollte dafür kämpfen.

These 3: Wenn mein Konzept nahe an dem ist, was am Ende rauskommt, umso besser.
(Überarbeitete These: Wenn mein Konzept nahe an dem ist, was am Ende rauskommt, umso mehr habe ich mich als Designer verbessert.)
These 4: Je kleiner mein Produkt ist, umso eher ist es möglich, dass ich im gesamten Prozess involviert bleiben kann.
Meine Meinung
tl;dr
UX Munich 2015: Eine Legende unterhält ein dankbares Publikum

Er hat sehr viel Wissen und Erfahrung an eine nächste Generation weiterzugeben. An öffentlichen Einrichtungen kann er das nicht mehr, zumindest nicht mehr gegen Honorar in Deutschland. Hat er auch verraten, denn: Spiekermann ist auch ein Quell von Anekdoten und gut getimten Pointen. Beide Ströme sind gut gefüllt worden in seiner langen Karriere. Dazwischen verstecken sich selbst im Weißraum des Kontextes Nuggets von Weisheit. Nicht so schnell verzehrt wie die vom Fastfood, sondern die kleinen Goldklumpen. (Bei diesem Vortrag freue ich mich besonders auf die Video-Dokumentation durch Five Simple Steps, die bald erscheinen wird.)

Und an diesem ersten Tag der UX Munich 2015 ist er der erste, der Klienten beim Namen nennt und deren Produkt beleidigt. Den Gummibärchengeschmack haben schon andere (wenig kreativ) Red Bull vorgeworfen. Aber als Kunde sei der Salzburger Weltmarktführer der beste, den er je gehabt habe. Sogar junge Projektmanager dürften da weitreichende Entscheidungen bei den digitalen Produkten treffen. Das findet er toll.
Was er nicht so toll findet: mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Das hat er zum Mantra seiner Arbeit in seinem Studio gemacht, das mittlerweile mehrere Standorte in aller Welt hat und über 100 Mitarbeiter. Weder bei Kunden noch bei neuen Mitarbeitern.
Don’t work with arseholes.
Erik Spiekermann, 2015
Bei Mitarbeitern sieht er sich in einem Wettkampf mit den Facebooks und Googles dieser Welt, und das meint er auch wörtlich. So habe er einen Mitarbeiter an Facebook verloren, wo dieser das Doppelte verdient habe. Mittlerweile ist dieser Ex-Mitarbeiter aber wieder einer seiner Mitarbeiter, weil ihm bei Facebook der kreative Input gefehlt habe. Auch die Arbeitszeiten bei Spiekermann sind andere. Wer länger als bis 19 Uhr für sein Tagwerk braucht, hat bei ihm nix verloren.
„Das sind Erwachsene. Die wollen das Beste geben. Und wenn sie sich den Kopf beim Footballzocken frei machen und dann wieder leistungsfähig sind… Damit habe ich lange nix anfangen können, aber ich muss das auch lernen. Das musst du machen. Sonst kriegst du keine guten Mitarbeiter mehr.
Spiekermann, 19.3.2015 (Paraphrasiert)
Man muss sich auf den Stil von Spiekermann einlassen. Von hier nach da springen, viel Lob für seine Geschichte, seine Company. Ich kann all die verstehen, die ihn nicht mögen und ihn für überheblich abtun. Aber er hat nun einmal viele Dinge gestaltet oder gestalten lassen, die wir alle kennen. Die Schrift von Nokia, die Schrift der Deutschen Bahn. All das kann er in einem kurzen Imagefilm vorführen. Aktuellstes Beispiel ist die Arbeit seiner Agentur für Mozilla. Da das Open-Source-Unternehmen bereits Meta als Schrift im Logo hatte, war das der Ausgangspunkt für die Überlegungen. Herausgekommen ist Fira, in sehr vielen unterschiedlichen Weiten.
Wem könnte der Vortrag vielleicht nicht gefallen haben?
- Praktizierer von Dienst nach Vorschrift
- Fans der iOS- und OS X-Hausschrift Neue Helvetica
- HR bei Silicon-Valley-Riesen
- Radfahrern in Funktionskleidung
- Miesepetern und Bedenkenträgern
- Red Bull
Was der Vortrag in mir ausgelöst hat
Meine persönliche Beziehung zu Spiekermann ist sehr durch Meta geprägt. Das war die Schrift einer meiner ersten Seminararbeiten an der Universität, es war die Schrift eines meiner ersten Arbeitgeber (WDR), der in meinem Heimat-Bundesland NRW nicht nur durch Radiowellen, sondern auch sein On-Air-Design prägend war. (Heute ist das in meiner beruflichen Heimat ProSieben mit seiner Helvetica, die zwar nicht mehr Hausschrift ist, aber meine Wahrnehmung immer noch sehr stark prägt. Disclaimer Hinweis: Als Product Owner arbeite ich prägend an der Prosieben.de-Website mit.) Auf der IA Konferenz habe ich auch schon mal eine Führungskraft aus Spiekermanns Team erleben dürfen, was auch ein Genuss war. Sehr tief in den Details drin, aber auch mit der Fähigkeit, davon zu abstrahieren. (Wenn ich mal groß bin, will ich auch so werden.)
Die allgemeinere Faszination für Schriftarten hat ein Kunstlehrer am Gymnasium geweckt. Ich bin sicher, es gehörte nicht zum Curriculum, aber in der siebten Klasse (glaube ich) haben wir Schriftarten und die ganzen Oberbegriffe gelernt. Seitdem weiß ich, was Grotesk auch sein kann. Guter Satz interessiert mich immer noch. Webfonts machen mich als Digital Product Designer immer noch sehr glücklich.
Es ist schön zu sehen, dass da jemand mit fast 70 steht, der immer noch Spaß an seinem Job hat und auch nicht davor zurückschreckt, sich neu zu erfinden und neue Dinge zu lernen. Agile ist für ihn kein Schreckgespenst, sondern Notwendigkeit. Lasten- und Pflichtenhefte mit mehreren Dutzend Seiten gehören aus dem Fenster geworfen.
tl;dr
Selbst wenn dich das Thema nicht interessiert – schau dir einen Vortrag von Spiekermann an. Das deutsche Wort dafür ist Gesamtkunstwerk, und so wie Kindergarten ist es zurecht in anderen Sprachen ein Lehnwort geworden.
Was ich mögen müsste, aber nicht mag: Kultur und Popkultur

An mir vorbeigegangen sind im Bereich
Kultur und Popkultur
- die Serie Lost
- Terry Pratchett
- Die Simpsons
- How I Met Your Mother
- The Big Bang Theory
- Two and a Half Men
- Jasper Fforde
- Thomas Mann
- William Faulkner
- Grey’s Anatomy
Menschen, die ich sehr mag, mögen diese Dinge. Einige davon spielen in meinem Beruf eine große Rolle, vor allem die Sachen, die ProSieben betreffen. Leider habe ich mich nicht für sie erwärmen können.