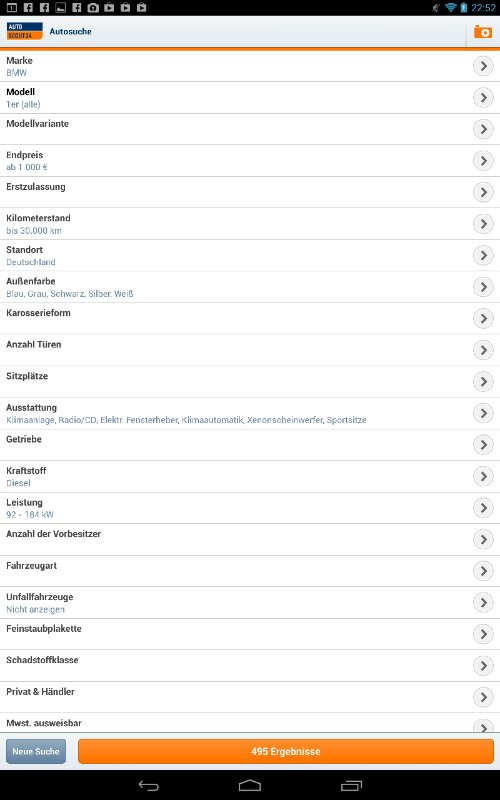Natürlich ist der Verlust von 120 Arbeitsplätzen eine Tragödie, besonders in einer strukturschwachen Region wie dem Ruhrgebiet, Sauerland und Siegerland.
Natürlich ist es eine Farce, dass der Verlag, der die Westfälische Rundschau betreibt, die Marke beibehalten will, aber das Gebäude Zeitungsprodukt dahinter komplett entkernen will, ja sogar abräumen.
Natürlich ist die Art und Weise, wie der Verlag in den letzten Jahren Konzernstrategie betrieben hat, gleichermaßen zynisch wie kurzsichtig.
Aber: Ist es wirklich schlimm, dass das publizistische Produkt WR nicht mehr existiert?
Wohl kaum.
„Sie glauben doch wohl nicht, dass auf Seite drei des Lokalteils in Dortmund noch Qualitätsjournalismus stattfindet?“
Dies oder zumindest sinngemäß waren dies die Worte von Prof. Dr. Hans Bohrmann in einem Presse-Seminar am Institut für Journalistik in Dortmund, an dem ich auch studiert habe. (Disclaimer Hinweis: Ich habe sogar zwei Jahre als freier Mitarbeiter für die Dortmunder Lokalredaktion der WAZ gearbeitet, im Anschluss an ein Pflichtpraktikum. Diesen Lokalteil hat die WAZ bei der Säuberungsaktion vor einigen Jahren bereits geschlossen.)
So nennt das ein Akademiker. Für Berufsstandkritiker wie Hardy Prothmann ist es Bratwurstjournalismus. Ich habe keinen Überblick über die Qualität der hinteren Seiten eines lokalen Zeitungsteils im Ruhrgebiet oder im Verbreitungssprengel der Westfälischen Rundschau. Aber meine wohl begründete Annahme ist es, dass es gerade in den kleineren Städten und kleineren Teams mit der Qualität nicht besser gestellt ist als bei den Lokalzeitungen in meiner neuen Heimat, dem bayerischen Alpenvorland. Während auf der ersten Seite im Lokalteil noch Featurefotos von professionellen Fotoredakteuren Eingang finden, finden sich im hinteren Teil nur Gruppenbilder, Reproduktionen von Bauvorhaben, zugesandte Vereinsbilder. Ich möchte hierfür Titelschutz für den Begriff Kaninchenzüchterjournalismus anmelden, in alter Harald-Schmidtscher Tradition.
Neben dem obligatorischen Bericht aus der Ratssitzung oder der Hauptausschusssitzung (kaum verständlich, weil die Vorgeschichte fehlt und einfach der Sitzungsverlauf nacherzählt wird, kaum Analyse vorhanden) stehen da die Fotos vom Spendenaufruf fürs Altenheim, die Ehrung der Jubilare und die Leuchtenaktion für einen sicheren Schulweg. Alles ehrenwerte Sachen, aber auch status-quo-erhaltend und schnarchlangweilig.
Kennen Sie noch eine Familie, in der die Eltern zwischen 30 und 40 sind und wo eine Tageszeitung auf den Tisch kommt? Nein, Journalisten- und Politikerpaare lassen wir nicht gelten. Für die 30 Euro im Monat, die eine mediokre Tageszeitung kostet, bekommt man ja schon fast das Fußball-Paket von Sky.
Was ist also bei der WR schief gegangen? Der Verlag hat vergessen, was die Basis seines Geschäfts ist, was ihn besonders macht. Das ist die direkte Kundenbeziehung. Die weiß man bei Sky sehr zu schätzen. Man hört direkt, wenn denen das Paket nicht gefällt, das äußert sich in Mails und an der Hotline.
Meine Erfahrung in der Tageszeitungsbranche sagt mir, dass an vielen Orten, wo Zeitung gemacht wird, der Leser als störendes Element betrachtet wird. Die Sonntagsreden von der Aufklärung und vom Kämpfen für den Leser – die sind genau das, Sonntagsreden. Da wird kalkuliert in Redaktionskonferenzen: „Wie viele Mitglieder hat der Verein, der Chor?“ Da wird die Seite mit den Leserbriefen zusammengestellt, die schlimmsten rechten und linken Verirrungen herausredigiert. Aber wenn der Empfang meldet: „Da ist jemand hier unten, der möchte sie sprechen“ – dann reagiert die nackte Angst.
Denn viele Zeitungsredakteure, mich damals eingeschlossen, wollen gar nicht den direkten Kontakt mit dem Leser. Damit sabotieren sie die eine Beziehung, die die Grundlage von allem ist. Wahrscheinlich haben die meisten Printredakteur vom Cluetrain Manifesto noch nie etwas gehört. Aber es ist die Wahrheit. Nennen wir hier mal nur die ersten vier Thesen:
- Märkte sind Gespräche.
- Die Märkte bestehen aus Menschen, nicht aus demographischen Segmenten.
- Gespräche zwischen Menschen klingen menschlich. Sie werden in einer menschlichen Stimme geführt.
- Ob es darum geht, Informationen oder Meinungen auszutauschen, Standpunkte zu vertreten, zu argumentieren oder Anekdoten zu verbreiten – die menschliche Stimme ist offen, natürlich und unprätentiös.
Das gilt für alle Unternehmen. Für die Telekom, wenn man an der Hotline schlecht behandelt wurde, bei Starbucks, wenn der Kaffee mal nicht schmeckt. Und sogar für Zeitungen.
Viele Lokalredakteure sagen dann immer: „Dafür war keine Zeit.“ Weil die Seiten auch anders vollgepflastert werden mit Content. Es geht aber im Journalismus nicht um Quadratzentimeter für Quadratzentimeter Content, es geht in erster Linie um die Menschen. Biete ihnen etwas an, was sie brauchen oder haben wollen, und sie werden kommen. Das zeigt der Erfolg der ach so entspannten Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Wenn jetzt also vom Erhalt der Medienvielfalt die Rede ist – glauben Sie den Verlagsspitzen der WAZ kein Wort. Es ist gut, dass diese Zeitung geht. Sie macht Platz für Innovation. Für lokale Blogs, mehr Qualität beim Wettbewerber Ruhr Nachrichten. Ich wünsche den ehemaligen WR-Mitarbeitern, einige habe ich vor Urzeiten auch mal getroffen, alles erdenklich Gute. Aber leider wird ihre Aktion wohl nicht fruchten. Die Rundschau ist gegangen. Der Verlag hätte sie komplett platt gemacht, wenn er sich nicht Anzeigen- und Aboerlöse erhoffen und Angst vor dem Kartellamt haben würde.
 Warum hat mich der Vortrag so interessiert und auch bewegt? Weil ich an einem ganz vergleichbaren Projekt arbeite – mit einem um ein Vielfaches kleineren Budget. Wir arbeiten auch mit Photoshop, ansonsten aber auch mit Axure und rapid prototyping.
Warum hat mich der Vortrag so interessiert und auch bewegt? Weil ich an einem ganz vergleichbaren Projekt arbeite – mit einem um ein Vielfaches kleineren Budget. Wir arbeiten auch mit Photoshop, ansonsten aber auch mit Axure und rapid prototyping.